Von Dr. Albert Wittwer
Gefahr für die Demokratie.
Ich möchte Sie nicht mit den Statistiken langweilen, ob eine Handvoll von Einzelpersonen die Hälfte des gesamten weltweiten, geldwerten Vermögens besitzen. Wie dröge ist die Diskussion, ob diese Statistiken – immerhin von durchaus renommierten Quellen – fehlerhaft sind. Fehler in dem Sinne, daß es auch zehn Prozent mehr oder weniger sein können.
Es ist auch nicht beeindruckend, daß sie sich als Tugendidole inszenieren. Sie verfügen und bestimmen über ihre Spenden und Stiftungen autonom. Die Spenden verringern oft ihre Steuerlast beträchtlich. Sie inszenieren sich als Innovatoren, als geniale Erfinder und Unternehmer, manchmal sogar als soziale Aufsteiger. Sie verzeihen die männliche Form, es fallen mir gerade keine Frauen aus der einsamsten Elite der Oligarchen ein. In Wahrheit wissen wir nichts von ihnen, außer dem, was sie – als Inszenierung – freiwillig preisgeben.
Keine Angst, es geht in diesem Text nicht um die Fragen, ob sie den Reichtum an uns Konsumenten redlich verdient haben, ob sie Steuern hinterziehen, ihre Zentralen als Briefkästen in Steuerparadiesen verstecken. Auch nicht um die Lüge vom Trickle-Down, daß vom Luxuskonsum der Superreichen alle profitieren, weil sie so viele Arbeitsplätze auf Jachten, in ihren Chalets und Penthäusern bereitstellen. Oder daß die Mehrung des Vermögens der Reichsten zugleich den Wohlstand der Ärmeren vermehre, wie das steigende Wasser bei Flut die kleinen wie die großen Schiffe anhebt.
Nein, was sie gefährlich macht, ist ihr dominanter Einfluß in der Demokratie. John Rawls hat schon vor Jahrzehnten beschrieben, daß die Menschen in Bezug auf ihre politischen, staatsbürgerlichen Rechte gleich sein sollen. Also daß Differenzierungen wie früher nach Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit – aber auch nach Bildung und Vermögen bzw. Einkommen – obsolet sind. Sie bergen die Gefahr des Entstehens von Oligarchie. Oder, kaum besser, der autoritären, der gelenkten Demokratie. Wenn man mindestens vielfacher Millionär sein muß, um für ein hohes politisches Amt anzutreten ist die Sache transparent. Wenn man – wie in großen Teilen der Welt – die Unterstützung von Millionären benötigt, sollten die Alarmglocken klingeln.
Den Milliardären gehören die elektronischen, internetbasierten Medien. Den Milliardären gehören bedeutende Zeitungen und TV-Sender. Wer glaubt, daß sie sich aus der Linie ihrer Medien heraushalten, möge weiter träumen, daß sich ökonomie-darwinistisch alles zum Besten wendet. Soeben hat der Fiat-Erbe John Elkan, Eigentümer des Economist, eine der beiden bedeutenden italienischen Tageszeitungen, La Repubblica, vorher dezidiert unabhängig, übernommen, der Chefredakteur wurde entlassen. Besonders originell war die lange aufrechterhaltene Behauptung von Google, das Management habe keinen Einfluß auf den Such-Algorithmus. Die Europäische Union hat damit aufgeräumt.
Was uns aktuell bedroht, ist die Intransparenz der Parteienfinanzierung. Noch besser wäre eine Obergrenze für Zuwendungen an Parteien. All das sollte für Rechnungshof und Gerichte einsehbar sein, was in Österreich nicht der Fall ist.
Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der Milliardäre, die „Stimmung für sie günstig zu beeinflussen“ immens. Ein bedeutender Österreichischer Unternehmer hat dutzende große, steuerfreie Schenkungen, zwischen € 200.000 und Millionenbeträgen an Personen getätigt, mit denen er nicht verwandt ist. Die Superreichen finanzieren Think-Tanks, Forschungsinstitute. Möglicherweise ist George Soros, von Ungarn hinausgeschmissen, „ein Guter“, aber er hat eine Agenda.
„Mit dem Leben in Freiheit, in einer liberalen Demokratie, müssen wir verantwortungsvoll umgehen.“ Wie können wir uns wehren? Die Medien, europäische Qualitätszeitungen, kritisch lesen. Den öffentlichen Rundfunkt unterstützen. In Korruptionsfällen nicht den Schluß ziehen, alle wären gleich. Das trifft nicht zu. Die Bekämpfung von Korruption als das Fieber betrachten, das die Viren entsorgt.
Bei Wahlen nicht den Unterhaltungswert, das schauspielerische Talent der Kandidaten bewerten. Wir sollten feststellen, ob die Wahlwerber für hohe Ämter autonom für etwas stehen, ein ethisches Fundament haben. Oder ob sie als trojanisches Pferd oligarchischen Interessen dienen.
Zitate: Schlagzeile frei nach WOZ Nr 19/2020 über Martin Schürz: Überreichtum, Campus Verlag 2019; John Rawls: Theory of Justice; OECD; Der Standard u.a.:Schenkungsliste Novomatic; BP Alexander VdBellen.

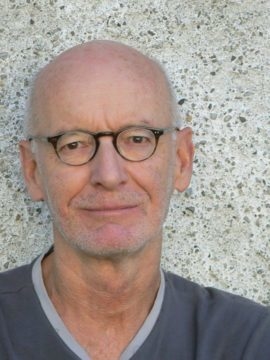























Vielen Dank für den kritischen Kommentar. Die Superreichen werden uns überall als Idole vorgesetzt. Ich sehe es kritisch wie sie überall Zeitungen und TV Sender aufkaufen. Dann gibts Jubelmeldungen. Ein Jeff Bezos der gerne auf dem Behindertenparkplatz parkt und Gewerkschaftsgründungen mit Kündigung quitiert bekommt dann in der Washington Post Lobeshymnen auf seine soziale Einstellung. Ach in Vorarlberg gibts da ja auch einen. Und für die gibt es dann Steuergeschenke ohne Ende.
Die wichtigste Frage fehlt mir. Wie kann eine Gesellschaft diese Entwicklung aufhalten? Das Vermögen dieser Personen vermehrt sich de facto von selber und ihr Einfluss ebenso. Eine Obergrenze für Milliardäre? Niemand darf mehr als 1 Milliarde besitzen? Wie dies durchsetzen. Ich denke wir stehen hier vor einer unaufhaltbaren Entwicklung.
Ihre Anmerkung ist mehr als berehtigt. Warum dulden wir den Superreichtum, weltweit? Martin Schürz, ein Wiener Psychiater, gibt in seinem Buch dazu antworten. Für viele Menschen ist die Welt, so wie sie vorgefunden wird, richtig. Sie akzeptieren das Bestehende, alles andere wäre wohl zu beunruhigend, jede Verhaltensänderung zu anstrengend. Nach der Diagnose, für die ich eintrete, könnte die Therapie beginnen. Für uns überzeugte Demokraten beginnt sie mit Wahlen, mit politischen Entscheidungen, die die Steuern, die soziale Bindung des Eigentums, den Schutz der demokratischen Teilhabe betreffen. Von Ökonomen völlig unerwartet hat uns das autoritäre China vorgeführt, daß staatlicher Einfluß auf die Wirtschaft nicht identisch mit ihrem Niedergang ist. Warum sollen dann Demokratien ihren Einfluß auf die Wirtschaft nicht drastisch ausbauen?
Ich stimme in allen Punkten zu. Mittlerweile bin ich aber verzweifelt. Welche Partei steht noch gegen die Superreichen auf? Die ÖVP ist eine reine Wirtschaftspartei geworden – mit Bedienung der Klientel von Benko & Co, die Grünen interessieren sich nur noch für ihre neue Macht, die SPÖ ist führungslos, die FPÖ/DAÖ – Ibiza, die Neos – auch nur an Steuersenkungen für Reiche interessiert. Was bleibt?
Ich denke, auch die Parteien sind immer in Bewegung und darauf angewiesen, auf die öffentliche Meinung zu reagieren. Sie und ich können unser Umfeld etwas beeinflussen und werden natürlich beeinflusst. Ich denke, es wäre am Anfang von größtem Nutzen, die Parteienfinanzierung zu begrenzen und völlig offen zu legen.
Schon die alten Griechen wussten genau, dass „Demokratie“ (=Herrschaft des Volkes) nur dann funktioniert, wenn man den überwiegenden Teil der Bevölkerung NICHT herrschen lässt. Auch wenn das Pendel inzwischen auch schon anders ausgeschlagen hat, es pendelt gerade zurück.
Die alten Griechen, eine Sklavenhaltergesellschaft. Pendelt das Pendel dorthin zurück? Vielleicht machen wir vorher einen Aufstand.
Nicht zurück zu den Sklaven, aber ein wenig hin zur Oligarchie der Reichen. War das nicht das Thema?
Ja, das siehst du richtig. Dahin hat das Pendel wirklich ausgeschlagen.
ich probiere es mal mit dem Fußball – da galt lange der Spruch – „Geld schießt keine Tore“ – ABER genau das Gegenteil ist der Fall – „Geld schießt Tore“ und zwar vielleicht nicht immer in einem Spiel – Aber immer in einer ganzen Saison – so werden immer Paris, Bayern, Barcelona oder Real vorne sein…So ist es – Das Problem ist das liebe Geld…aber gibt es eine Alternative zum Geld und der damit verbundenen Macht??? Wobei – wenn ich meine eigenen Zeilen lese – nein das Problem ist nicht das Geld, sondern einige Menschen hinter diesem Geld.
Die Wählerinnen und Wähler der Gmeinde Ludesch haben durch Volksabstimmung einen Liegenschaftsdeal Rauch/RedBull mit großer Mehrheit verworfen. Sehr viel Geld war im Spiel, die Gemeinde, die Pfarre hatten schon einstimmig zugestimmt. Auch die Printmedien, die von den Inseraten der bedeutenden Industrie leben, konnten die Meinung der Bevölkerung nicht aushebeln. Die Demokratie bewies ihre Widerstandskraft aus guten Gründen. Ähnlich in Hard, wo die Verbauung des großartigen Bodenseeufers durch Volksabstimmung vereitelt worden ist.
Frau Heidi Horten, Frau Kathrin Glock und Herr Johann Graf hätten vor dem Ausschuß des Nationalrates aussagen sollen. Eine gesetzliche Verpflichtung. Sie entschuldigten sich: mit Krankheit. Der Standard, 5.6.2020, S 32