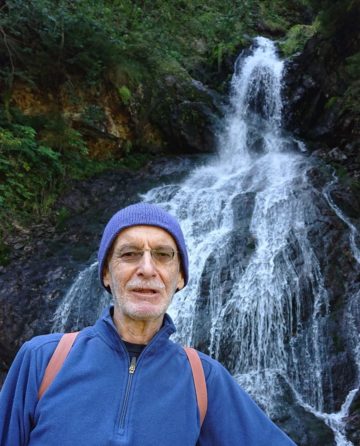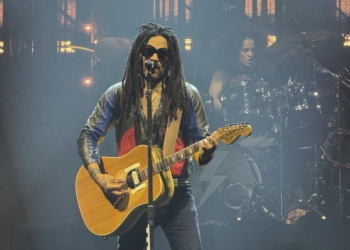Von Albert Wittwer
Die wohl wichtigste Voraussetzung für die Erlangung und Ausübung politischer Macht in der Demokratie ist es, wahrgenommen zu werden. Die Aufmerksamkeit der Wählerinnen und Wähler, der Klientel, gilt es, zu bekommen und zu steigern und zu behalten. Darum beschäftigt der Kanzler eines Kleinstaates auf unsere Kosten rund zweihundert persönliche Mitarbeiter, die für ihn die Medienlandschaft beobachten und pflegen und täglich ein Wording und Setting vorschlagen, wie und worüber sich der Chef öffentlich äußern und in Erscheinung treten soll. Bei der Kanzlerin Doktor Bierlein, die sich nicht um ein Regierungsamt beworben hat oder bewerben will, genügten siebzig.
Unsere Aufmerksamkeit ist beschränkt. Sie ist kostbar. Multitasking, das Erledigen mehrerer sie beanspruchender Aufgaben, ist obsolet, die Fähigkeit dazu eine unbewiesene Legende. Wir können vielleicht bei einfacher manueller Arbeit zugleich beten. Während des Wanderns nachdenken, allerdings nicht mehr am Klettersteig. Wer unsere Aufmerksamkeit besetzen kann, ist auf dem Weg zur Macht schon weit.
Wie erlangen also die Politiker unsere Aufmerksamkeit?
Früher redeten sie von der Kanzel, verzeihen Sie, vom Balkon herab. Sonst gibt es noch einige Zeitungen, um darin zu inserieren und dann Pressekonferenzen zu geben. Wir kennen, wenn wir wollen, immerhin die Journalistinnen und Redakteure, die einen Ruf zu verlieren haben. Der Content ist sozusagen redaktionell und professionell gefiltert. Das halte ich für einen riesigen Vorteil. Niemand von uns Leserinnen und Lesern ist imstande, alle politischen Studien, Aussagen, Meinungen selber zu lesen, noch weniger sie auf Quellen zu überprüfen.
Heute kann ohne die sozialen Medien in der Demokratie niemand die politische Macht erringen oder behalten. Die Auswahl, wer dort präsent ist, bestimmt angeblich ein Algorithmus. Sie erinnern sich vielleicht an den Beginn, als gefühlt alle Beiträge ihrer Freundinnen und Freunde für sie sichtbar waren. Sie ist längst vorbei. Wenn Sie ein Kätzchen- oder ein Berg-Bildchen einstellen, das sind wirklich extrem beliebte Content-Sujets, kann der Konzern bequem daneben Werbung schalten. Sonst werden ihre Bemerkungen nur von fünf Ihrer, sagen wir dreihundert „Freunde“ überhaupt gesehen.
Außer Sie bezahlen dafür – wie die Parteien. Diese wiederum begnügen sich nicht mit der aus Steuern gespeisten Parteienförderung und den Mitgliedsbeiträgen, sondern lassen sich „spenden“. Was sie von wem bekommen, darf der Rechnungshof nicht untersuchen. Er bekommt nur eine Aufstellung, die ein von der politischen Partei händisch ausgesuchter Wirtschaftsprüfer bestätigt.
Da sind, wie der Kabarett-Künstler Gery Seidl, eindrucksvoll nachweist, die Spitzensportler den Spitzenpolitikern weit überlegen: Sie tragen die Namen der Sponsoren auf Hemd, Helm und Kappe. Aber er meint, auf den enganliegenden, maßgeschneiderten Sakkos des Kanzlers wäre sowieso zu wenig Platz.
Im gegenwärtig nahezu unregulierten Zustand sind die Sozialen Medien, wie schon Trump von seinem „Dreckschleuderhochsitz“ bewiesen hat, eine große Gefahr für den Weiterbestand unserer liberalen Demokratie. Daher prüft die Europäische Union, ob diese Elemente des Internets im Wesentlichen als Versorgungsbetriebe im Bereich der Information oder öffentliche Fernmeldedienste behandelt gehörten. Mit etwas Glück wird sie sich der der Monopolmacht und ihrer Kontrolle annehmen. Von unseren gesponserten politischen Chefs ist das nicht zu erwarten.