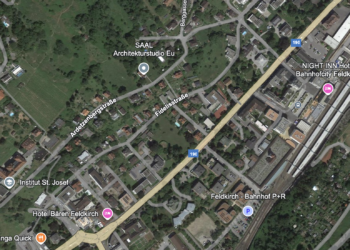Der renommierte Vorarlberger Historiker und Gründer der Rheticus Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. Gerhard Wanner, stellt Gsi.News seine erst Ende 2025 veröffentlichte Publikation zu einem Thema zur Verfügung, welches in der Geschichtsschreibung ein Novum darstellt und seinesgleichen sucht: Das Leben der Frau vor 100 Jahren. Teil 1 widmet sich der Arbeit und dem Beruf.
Von Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Wanner
Die Abstimmung über den Zusammenschluss der selbstständigen Gemeinden Feldkirch, Altenstadt, Tosters und Tisis zu „Großfeldkirch“ fand am 26. April 1925 statt. Das Territorium der Stadt Feldkirch wuchs von 1,3 auf 34 km2 an, die Einwohnerzahl stieg von 4.900 auf 12.000 Personen. Die wichtigste Ursache für diese nachhaltige Übereinkunft war wirtschaftlicher Natur – die Überwindung der Depressionen durch den Ersten Weltkrieg und die katastrophale Inflation. Über den Jahrzehnte dauernden Prozess bis zur Eingemeindung und deren politische Vorgänge sind wir historisch gut informiert. Ihre Betreiber waren ausschließlich Männer. In diesem Zusammenhang spielten jedoch Frauen eine entscheidende Rolle: Seit 1919 besaßen sie das Wahlrecht und noch dazu als Pflicht! Es entschieden somit etwa 1650 wahlberechtigte Frauen die jeweiligen Wahlergebnisse und damit das Schicksal der Stadt. Ein weiterer Schwerpunkt war ihre bedeutende Rolle in der städtischen Sozialfürsorge.
Der größte Teil der weiblichen Bevölkerung arbeitete als Hausfrauen, hauswirtschaftlich Beschäftigte oder „Dienstmädchen“. Ihre Tätigkeiten wurden kaum hinterfragt und wenig geschätzt. Hausfrausein war gottgewollt und entsprach einer „natürlichen Ordnung“. Ein Bericht auf der Titelseite des Feldkircher Anzeigers über ein tragisches Mutterschicksal widerspiegelt die herrschende Frauenrolle: „Frau W. war eine von jenen beliebten Frauengestalten, die bei strengster Pflichterfüllung in der Familie und bescheidenster Lebensführung sich der allgemeinen Hochachtung erfreuten.“ Sie verstarb bei der Geburt ihres vierten Kindes – „Opfer ihres mütterlichen Berufes“ – wie es hieß. (FA, 20.12.1924)
Von aktiver Parteiarbeit und politischen Entscheidungen waren Frauen ausgeschlossen. Für die traditionelle Geschichtsschreibung Vorarlbergs fanden daher ihre Lebensweise, ihre Rollen und ihr Alltag kaum Beachtung. Die Ausnahme ist Ebenhoch Ulrike: 1986 erschien ihre Masterarbeit über „Die Stellung der Frau in der Geschichte Vorarlbergs 1914-1933.“
Dieser Beitrag ist der Versuch, diese Lücke etwas zu füllen. Die wichtigsten Quellen waren Vorarlbergs ideologisch orientierte Zeitungen aus den Jahren 1924/1925, im speziellen Fall vor allem der „großdeutsche“ Feldkircher Anzeiger mit seiner lokalen, den historisch kleinen Altstadtkern betreffenden Berichterstattung. Es war das letzte Aufleuchten einer achthundertjährigen Geschichte, eine Zeitenwende!
Arbeit und Beruf
In der überwiegend konservativen und liberalen bürgerlichen Gesellschaft Feldkirchs bestand der erste und wichtigste Zweck einer Frau darin sich zu verehelichen, um Kinder zu gebären und aufzuziehen – die Basis für die glorifizierte Familie. Frauen sahen ihre Lebensversorgung, ihre gesellschaftliche Rolle und ihre „Berufung“ innerhalb der Ehe als Hausfrau und Mutter. Diese gesellschaftliche Aufgabe war jedoch nicht neu und besaß im Land Vorarlberg eine stabile und kaum angezweifelte Tradition.
Diese bürgerliche Exklusivität verwirklichte sich in Feldkirch jedoch nur für einige hundert Frauen. In der Umgebung außerhalb des begrenzten Stadtkerns, vor allem im flächenreichen Altenstadt, lebte ein großer Teil der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Hier hatten bereits „Mädchen“ mit körperlichem Einsatz „ihren Mann“ zustellen, vom Hof über die Felder bis zur Viehalpe. War der landwirtschaftliche Betrieb unrentabel und brachten Heimgewerbe wie Weben und Sticken zu wenig Einkommen, verlagerten Frauen ihre Tätigkeiten in die Textilbetriebe. (Ebenhoch, 110)
Dort trafen sie auf meist unverheiratete Frauen und Mädchen aus dem Arbeitermilieu, in dem es wenig Verständnis für kindliche Bedürfnisse und für eine Schulausbildung gegeben hattw. Zu Hause herrschte die strenge Autorität des Vaters. Die Arbeitertöchter waren das ungelernte, bestenfalls das angelernte, schlecht entlohnte Personal in den Textilbetrieben Hämmerle und Ganahl. Mädchenerziehung bedeutete Unterordnung, Anpassung, Abfinden mit der unentrinnbaren Lage. Eine Verehelichung mit unerwünschten Kindern verschlimmerte meist die Situation.
Von einer Frauenemanzipation konnte in Vorarlberg vor dem Ersten Weltkrieg keine Rede sein. Das Kriegsgeschehen und die politische Zwangsbeteiligung an den Wahlen seit 1919 änderte jedoch ihre Lage. Weibliches Selbstbewusstsein nahm zu, gefördert durch soziale Aktivitäten in den selbstständigen Frauenvereinen. Die sozialistische Zeitung „Vorarlberger Wacht“ gab 1924 eine ergänzende Erklärung: „Mit der Berufstätigkeit steigt der Persönlichkeitswert der Frau, die auch mehr Anteil nimmt und dadurch auch mitwirkt an der Gestaltung des Staatswesens und der Gesetzgebung. Die modern denkende Frau wird ihren Einfluß überall dort geltend machen, wo es gilt, der Persönlichkeit der Frau den Weg zu bahnen aus Abhängigkeit und Unterdrückung.“ (VW, 26.1.1924)
Die Mehrheit der kleinstädtischen Gesellschaft war jedoch bestrebt, die traditionelle Frauenrolle zu erhalten und zu stärken. „Löbliche“ Vorbilder wurden im Feldkircher Anzeiger hervorgehoben: Da gab es auf der Titelseite die „besten Glückwünsche“ für die Trauung Jungvermählter, die Feier des 25. Jahrtages einer Vermählung und in der Pfarrkirche sogar die Feier einer Goldenen Hochzeit. Am 13. August 1924 war als Mahnung aber auch zu lesen: „!! Achtung!! Ich mache hiermit bekannt, daß ich für auf meinen Namen gemachte Schulden durch meine Frau I. B., Schlosserheizers-Gattin in Feldkirch, nicht aufkomme und noch bezahle. Gebhard B. (abgekürzt) Bundesbahn-Angestellter.“
Feldkirch war zu dieser Zeit eine Beamtenstadt mit Kleinhandel und Kleingewerbe. In kapitalarmen Ein- bis Zweipersonen-Betrieben arbeiteten Frauen vor allem als Schneiderinnen, Kleidermacherinnen, Stickerinnen, Näherinnen und Hutmacherinnen. Spezielle Dienstleistungen bot das Gastgewerbe. Häufig waren diese Berufe mit erweiterter Hausfrauenarbeit verbunden. Es gab auch einzelne Unternehmen, die von „Witwen“ weitergeführt wurden, so etwa die Möbelhandlung Witwe Hagg in der Neustadt und die Gemischtwarenhandlung Witwe Anna Hefel.
Zahlreich waren die weiblichen Dienstboten, die auch in die Schweiz angeworben wurden. Ihr Beruf besaß bei geringer persönlicher Freiheit und psychischen Belastungen meist niedriges Sozialprestige. Eine 16jährige Dienstmagd aus Levis kehrte zu ihrem Dienstplatz nicht mehr zurück und hinterließ dort die tragischen Zeilen: „Sie können mir in die Ill das Kreuzlein stecken, ich will jetzt ruhen im kühlen Sande. Gott hat es so gewollt.“ (FA, 5.7.1924)
In den beiden Textilbetrieben, Ganahl in Feldkirch-Frastanz und Hämmerle in Gisingen, arbeiteten auch noch in den 20er Jahren meist „nicht-bürgerliche Mädchen“, deren Vorfahren als Besitzlose aus dem italienischen Südtirol eingewandert waren. Durch die Wirtschaftskrise wurden viele arbeitslos und bemühten sich um einen Arbeitsplatz in einem Haushalt. „Jedoch dauerte es in der Regel keine 24 Stunden, da erschienen sie schon wieder bei der Arbeitsnachweisstelle, weil sie den ihnen zugewiesenen Posten angeblich nicht versehen können: Ich bin Fabriksarbeiterin oder ich bin Stickerin, verstehe nichts vom Häuslichen, kann nicht einmal einen Kaffee kochen.“ (FA, 19.2.1919)
In öffentlichen Führungspositionen spielten Frauen keine Rolle. Das höchste Prestige besaßen die Klosterschwestern des Instituts St. Josef, die wenigen weltlichen, jedoch zölibatären Volksschullehrerinnen und jene Mädchen, die sich an der privaten Bürgerschule der Kreuzschwestern oder in Dornbirn an der Mädchen-Fortbildungsschule ausbilden konnten und daher über gewisse Allgemeinbildung und Verwaltungsfähigkeiten verfügten. Als „Lehrmädchen“- sie sollten „brav, treu und fleißig“ sein – gab es Aufstiegsmöglichkeiten, so etwa als „Laborantin in der Stadtapotheke“.
Frauenarbeit gab es in Feldkirch auch in sogenannten „technischen Berufen“. Man verstand darunter Stenotypistinnen, Telefonistinnen und Verkäuferinnen. Als „gewissenhaft“ bewarb sich zum Beispiel eine „Buchhalterin, perfekt in Stenographie und Maschinschreibens kundig“. An anderer Stelle suchte eine gewerbetreibende Familie ein „Fräulein vormittags für den Haushalt, nachmittags für die Buchhaltung“. Als „Haushälterin bei einem älteren Herren“ bewarb sich ein „gesetztes, besseres Mädchen aus guter Familie mit guten Zeugnissen“. Vermutlich ebenfalls von einem Mann wurde „gesucht per sofort ein tüchtiges Mädchen, das gut bürgerlich kochen kann und in den übrigen Hausgeschäften bewandert ist“. (FA, 5.1.1924)
Die Diskussion um weibliche Lohnarbeit wurde emotionsreich geführt. Die Christlichsozialen waren grundsätzlich dagegen. Die Großdeutschen entwickelten gewisse emanzipatorische Vorstellungen. Sie waren jedoch ebenfalls der Meinung, dass die „Erfüllung“ der Frau als Mutter und Erzieherin im „Dienst an der Familie“ aufzugehen habe. Sie gehörten meist zur bürgerlichen Oberschicht Feldkirchs. Ihre erzieherischen Aufgaben waren nicht religiös orientiert, sondern galten der „Pflege des deutschen Wesens“, der Abwehr fremder geistiger Einflüsse und der Förderung bewährter Eigenschaften, die einst den Germanen das Überleben und ihre Macht gesichert hatten – „Schlichtheit, Wahrhaftigkeit, Treue, Tugendhaftigkeit und Willenskraft“. Sie waren Mitglieder im „Deutschen Schulverein“. In Feldkirch gab es einen solchen 1910, er wurde von einer Obfrau aus der Fabrikantenfamilie Ganahl geleitet. (W 2012, 55)
Die Sozialdemokraten traten für weibliche Lohnarbeit ein, da diese für die Erhaltung einer Arbeiterfamilie von Nöten war. Nur wenige Frauen aus ihrem Milieu entwickelten ein Klassenbewusstsein und waren zu politischer Parteiarbeit bereit. Ihr „reaktionäres“ Vorbild war die bürgerliche Familie. (Ebenhoch, 64-81)
Dennoch riefen die Sozialdemokraten im März 1924 zum „Frauentag“ auf, der nicht mit dem gleichzeitig initiierten Muttertag ident war. 1911 hatte der internationale Frauenkongress in Kopenhagen erstmals dazu aufgerufen. Bei den wenigen „landfremden“ Sozialistinnen Feldkirchs fiel der Frauentag jedoch auf fruchtbaren Boden: Frauen – „auch Männer haben Zutritt“ – trafen sich im Gasthof „Rose“ in Levis, dem Parteilokal, und forderten weitgehende Maßnahmen: „(…) die Befreiung der Frau von den unerträglichen Lasten, die ihr als dem schwächsten Teil der Gesellschaft aufgebürdet werden, wir demonstrieren für die Aufhebung des Mutterschaftszwanges, wir erheben Anspruch auf gleichen Lohn und gleiche Arbeit, wir fordern gute Schulen und Fortbildungsmöglichkeiten für begabte Kinder des Proletariats. Wir demonstrieren für die politische Gleichberechtigung.“ (VW, 25. und 29. 3.1924)
Eine Tätigkeit von Frauen, die weder als Beruf noch als Arbeit angesehen wurde, jedoch große gesellschaftliche Bedeutung besaß, war ihr soziales Engagement in Frauenvereinen. Sie kamen, materiell abgesichert, fast ausschließlich aus dem bürgerlichen Milieu und erwarben sich öffentliche Anerkennung.