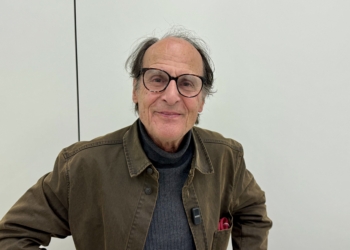Der Kratzer im Denkmal – 80 Jahre Kriegsende und die vergessene Geschichte
Ein Kommentar zum Umgang mit Geschichte und Erinnerung anlässlich der Veranstaltung im Theater am Saumarkt in Feldkirch.
80 Jahre Kriegsende. Ein runder Jahrestag, der zum Innehalten einlädt – zum Erinnern, Nachdenken und auch zum Hinterfragen. Was 1945 wie eine Befreiung aussah, wurde vielerorts ganz anders empfunden. Die Alliierten rückten vor, die Nationalsozialisten versuchten noch wichtige Brücken oder gar Staudämme zu sprengen, flohen oder versteckten sich – der Krieg war vorbei, aber die Angst blieb. Besonders in Vorarlberg.
Als die französischen Truppen im Frühjahr 1945 über den Rhein kamen, führten sie nicht nur Waffen mit sich, sondern auch Soldaten aus ihren Kolonien – Marokkaner, die als Teil der französischen Armee über das Montafon und die Illschlucht nach Feldkirch gelangten. Für viele Vorarlberger war das keine Stunde der Erlösung, sondern eine der Verunsicherung. Die vermeintlichen Befreier wurden oftmals als Bedrohung empfunden, nicht bei allen als Hoffnungsträger. Die Uniformfarbe mag gewechselt haben, doch das Gefühl vieler war: Nun sind neue Herren da.
In einer Veranstaltung im Theater am Saumarkt, die den Titel „80 Jahre Kriegsende, Film und Gespräch: Avec la 4e Division Marocaine de Montagne“ trug, wurde dieses dunkle Kapitel der Landesgeschichte künstlerisch beleuchtet – mit gemischter Resonanz. Die russischstämmige, in Berlin lebende Künstlerin Stefania Smolkina, die als „artist in residence“ eingeladen wurde, zeigte ihren trägen Film über den sogenannten „Marokkanerstern“, ein rotes Pentagramm, das 1945 von marokkanischen Soldaten in die Felswand an der Ill gemeißelt wurde. Heute liegt es unkommentiert nahe eines Klettergartens – für viele bloß ein skurriles Symbol am Wegesrand. Für andere: ein stummes Denkmal, das noch immer keine Stimme hat.
Doch genau hier beginnt das Problem. Der Film, so ambitioniert und künstlerisch auch gestaltet, verpasste eine wichtige Gelegenheit: Den Dialog mit jenen, die noch da sind. Die Zeitzeugen. Die, die nicht spekulieren, sondern erzählen können – aus erster Hand. Stattdessen blieb das Gezeigte fragmentarisch, ästhetisch, aber inhaltlich dünn. Auch bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit Anne Zühlke vom DOCK20-Kunstraum und Sammlung Hollenstein und dem Obmann der Johann-August-Malin-Gesellschaft Johannes Spies kam nicht viel Tiefgreifendes heraus. Salopp gesagt, ein altes Geschichtsbuch abzufilmen ist schließlich nicht jedermanns Geschmack und hier hätten die Verantwortlichen besser auf das Endergebnis achten und rechtzeitig eingreifen sollen. Das Publikum reagierte entsprechend zurückhaltend, teils irritiert. Verständlich, denn Geschichte lebt von Tiefe, nicht nur von Bildern, die oft nicht mal Symbolbilder, sondern aus dem Kontext gerissene Fragmente waren. Und für eine echte „oral history“ war noch reichlich Luft nach oben!
In Gesprächen nach der Veranstaltung wird klar, wie stark die Erinnerungen noch brennen. Eine 98-jährige Frau schilderte, wie sie als junge Angestellte in der heutigen Bezirkshauptmannschaft Feldkirch den Einmarsch der Franzosen und ihrer dunkelhäutigen Soldaten miterlebte: Männer mit Mulis, Turbanen, Dosenfleisch – und einem völlig fremden, oft furchteinflößenden Verhalten: „Sie öffneten die Fenster und schmissen die Schreibmaschinen hinaus. Überall haben sie hingeschissen.“ Es ist eine Erinnerung, die nicht verklärt, sondern verstört. Eine, die man nicht romantisieren, aber auch nicht verdrängen darf. Die Dame schließt: „Es ist Geschichte – unsere Geschichte, die gerne vergessene.“
Warum also steht dort an der Ill keine Tafel? Kein Hinweis? Kein Versuch, diesen Ort zu einem Platz der Erinnerung zu machen? Das Pentagramm ist Teil unserer Vergangenheit – ob man es nun mag oder nicht. Auch das ist Denkmalkultur: nicht nur das Glatte, das Heroische, sondern auch das Sperrige sichtbar machen. Gerade in einer Zeit, in der kollektives Erinnern zusehends zur Inszenierung wird, braucht es solche echten, unbequemen Orte.
Was ebenfalls fehlt: Eine offene Debatte über die Nachfahren jener Zeit. Kinder von Marokkanern, gezeugt in einem Feldzug der Ambivalenzen – kaum jemand spricht darüber. Die Geschichten von „vollen Bäuchen“ und „vollen Bäuchen“, wie es eine Zeitzeugin formulierte, sind bitter und wahr zugleich. Auch das gehört zur Wahrheit: Nicht jede Befreiung kommt mit Jubel, nicht jeder Sieg ist sauber. Die französische Trikolore brachte den Frieden, aber auch das Chaos. Auch davon erzählen die alten Feldkircher oder einem Dornbirner Zeitzeugen blieb in Erinnerung, wie die Marokkaner vom Zanzenberg auf den Zwiebelturm der Sebastiankirche im Oberdorf geschossen und es unter den wenigen Männern aus Vorarlberg und den neuen Besatzern – sowohl den hell- als auch dunkelhäutigen – öfters zu Prügeleien kam, meistens ging es dabei um Frauen. „Die Marokkaner haben bei den Röcken nichts anbrennen lassen.“
Es bleibt also viel zu tun. Erinnerung braucht Kontext, Raum und Ehrlichkeit. Vielleicht ist es an der Zeit, dass Stadt und Land dieses Kapitel nicht länger ignorieren. Ein Denkmal für den „Marokkanerstern“ wäre ein Anfang – nicht als Ehrenzeichen, sondern als Mahnmal. Und als Einladung zum Gespräch. Denn wie sagte die alte Dame am Ende ihres Berichts? „Es war eine verrückte Zeit. Aber sie gehört uns.“